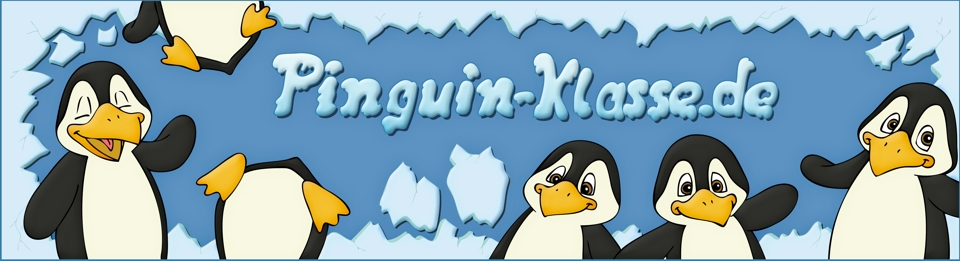
| 2025 | ||
| <<< | April | >>> |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |


ø pro Tag: 0
Kommentare: 1362
ø pro Eintrag: 7,1
Online seit dem: 01.01.2011
in Tagen: 5233
Ausgewählter Beitrag
Bildung braucht Persönlichkeit
Nun liegt Gerhard Roths Buch "Bildung braucht Persönlichkeit - Wie Lernen gelingt" schon eine geraume Weile hier bei mir und ich habe Wochen gebraucht, um mir die Zeit zu nehmen, dieses interessante Werk zu lesen.
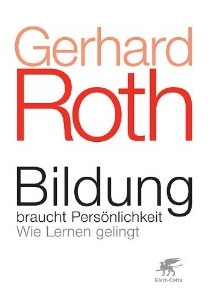
Bestellt hatte ich es mir im Frühjahr, aus Interesse ebenso wie aus reinem Pflichtgefühl, weil mir bewusst ist, dass ich mich viel mehr mit der neurobiologischen Forschung auseinandersetzen müsste.
Häufig greife ich eher zu praxisorientierten Büchern, zu Ideen und Anregungen, die ich am nächsten Tag umsetzen und einführen kann.
Natürlich habe ich einige Bücher von Manfred Spitzer gelesen, der immer wieder auf die Zusammenhänge der aktuellen Gerhirnforschung und dem Lernen verweist, wie beispeilsweise hier bei "Geist und Gehirn".
Mir fehlte jedoch häufig der Ansatz vom Lehrenden aus zu denken, bzw. zu berücksichtigen, in wie weit Lehrende in Systemzwängen stecken.
In seinem Buch schreibt Gerhard Roth (S.15), an einer Stelle, an der er auf die Zusammenarbeit der drei Bildungsinstitutionen in Deutschland - Bildungsbehörden, Professoren der Didaktik und Pädagogik sowie Lehrende - eingeht:
"Schließlich gibt es die große Gruppe der Lehrenden, die sich mehr oder weniger redlich abmühen. Ihre Situation ist widerum besonders bemerkenswert. Zum einen kennen sie die modernen pädagogisch-didaktischen Konzepte nicht bzw. haben das, was sie davon in der Hochschule einmal erfahren haben, längst vergessen, zum anderen halten sie solche Konzepte hinsichtlich ihres Berufsalltags für wertlos [...]"
Ich stimme Gerhard Roth zu, gehe aber weiter und frage: Warum ist dem so?
Kolleginnen und Kollegen, die sich interessieren, befassen sich sehr wohl mit modernen pädagogisch-didaktischen Konzepten, werden aber häufig schulisch an ganz anderen, belastenden Fronten gefordert, so dass das Auffrischen von Kenntnissen oftmals anderen Problemen zum Opfer fällt.
Das soll keine Entschuldigung sein, lediglich der Versuch einer Erklärung.
Roth führt weiterhin aus, dass sich viele Lehrer ihr Unterrichtskonzept selbst erarbeitet haben und die Meinung vertreten, das sei gut so und ginge gar nicht anders. (S.15)
Als Ursachenerwägung zieht Roth heran:
"Dieses Manko kann zweierlei Ursachen haben. Zum einen kann es sein, dass sich Pädagogen und Didaktiker - wie viele Experten ihnen vorwerfen - zu sehr um das Konzeptuelle und Prinzipielle kümmern und nicht um die Praxis.
Zum anderen kann es aber auch daran liegen, dass sie sich nicht genügend um Erkenntnisse der empirischen Wissenschaften wie der Psychologie oder - neuerdings - der Neurobiologie kümmern, sondern im eigenen Saft schmorgen." (S. 16)
Wenn ich mir anschaue, in wie vielen Themenfeldern und auf wie vielen Gebieten von Lehrenden gefordert wird, dass sie Experen seien, Fachleute, dann kann man Angst bekommen vor dem Wust und der Fülle an komplexen Themen und Bereichen und weiß im ersten Moment vielleicht gar nicht, wo man beginnen mag.
Nach dem Lesen des Buches, wäre ein erster und äußerst wichtiger Ansatz, bei jedweder Planung zu berücksichtigen, wie das Gehirn funktioniert. Lehren und Lernen gänzlich darauf einzustellen und dies als Basis zu nehmen.
Laut Roth können zwingend notwendige Verbesserungen des Schulwesens nur auf diese Art und Weise realisiert werden.
Roths Buch macht immer wieder darauf aufmerksam, wie entscheidend die Persönlichkeiten von Lehrendem und Lernenden auf das Lernen einwirken.
An manchen Stellen war es mir doch sehr fachspezifisch und theorielastig, aber insgesamt macht das Werk Lust darauf, sich näher mit der Thematik auseinanderzusetzen.
Ganz offene Türen hat der Autor dann ja ziemlich am Ende seines Buches bei mir eingerannt.
Dort geht er auf Unterrichtsformen ein (S.296):
"Über die besten Unterrichtsformen wird zur Zeit viel gestritten, und vieles wird ausprobiert, ohne dass es irgendwelche empirischen Validierungen gibt. Man wird sich deshalb dem Abschied vom Traum der optimalen Unterrichtmethode anschließen müssen, wie Hilbert Meyer (2004) ihn propagiert, und stattdessen eine gesunde Mischung der drei Grundformen, nämlich von Frontal - und Lehrgangsunterricht, Gruppen- und Projektunterricht und Frei- bzw. Einzelarbeit praktizieren."
Es lohnt sich also durchaus, sich die Zeit zu nehmen, auch einmal solche Bücher durchzulesen.
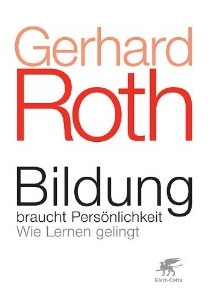
Bestellt hatte ich es mir im Frühjahr, aus Interesse ebenso wie aus reinem Pflichtgefühl, weil mir bewusst ist, dass ich mich viel mehr mit der neurobiologischen Forschung auseinandersetzen müsste.
Häufig greife ich eher zu praxisorientierten Büchern, zu Ideen und Anregungen, die ich am nächsten Tag umsetzen und einführen kann.
Natürlich habe ich einige Bücher von Manfred Spitzer gelesen, der immer wieder auf die Zusammenhänge der aktuellen Gerhirnforschung und dem Lernen verweist, wie beispeilsweise hier bei "Geist und Gehirn".
Mir fehlte jedoch häufig der Ansatz vom Lehrenden aus zu denken, bzw. zu berücksichtigen, in wie weit Lehrende in Systemzwängen stecken.
In seinem Buch schreibt Gerhard Roth (S.15), an einer Stelle, an der er auf die Zusammenarbeit der drei Bildungsinstitutionen in Deutschland - Bildungsbehörden, Professoren der Didaktik und Pädagogik sowie Lehrende - eingeht:
"Schließlich gibt es die große Gruppe der Lehrenden, die sich mehr oder weniger redlich abmühen. Ihre Situation ist widerum besonders bemerkenswert. Zum einen kennen sie die modernen pädagogisch-didaktischen Konzepte nicht bzw. haben das, was sie davon in der Hochschule einmal erfahren haben, längst vergessen, zum anderen halten sie solche Konzepte hinsichtlich ihres Berufsalltags für wertlos [...]"
Ich stimme Gerhard Roth zu, gehe aber weiter und frage: Warum ist dem so?
Kolleginnen und Kollegen, die sich interessieren, befassen sich sehr wohl mit modernen pädagogisch-didaktischen Konzepten, werden aber häufig schulisch an ganz anderen, belastenden Fronten gefordert, so dass das Auffrischen von Kenntnissen oftmals anderen Problemen zum Opfer fällt.
Das soll keine Entschuldigung sein, lediglich der Versuch einer Erklärung.
Roth führt weiterhin aus, dass sich viele Lehrer ihr Unterrichtskonzept selbst erarbeitet haben und die Meinung vertreten, das sei gut so und ginge gar nicht anders. (S.15)
Als Ursachenerwägung zieht Roth heran:
"Dieses Manko kann zweierlei Ursachen haben. Zum einen kann es sein, dass sich Pädagogen und Didaktiker - wie viele Experten ihnen vorwerfen - zu sehr um das Konzeptuelle und Prinzipielle kümmern und nicht um die Praxis.
Zum anderen kann es aber auch daran liegen, dass sie sich nicht genügend um Erkenntnisse der empirischen Wissenschaften wie der Psychologie oder - neuerdings - der Neurobiologie kümmern, sondern im eigenen Saft schmorgen." (S. 16)
Wenn ich mir anschaue, in wie vielen Themenfeldern und auf wie vielen Gebieten von Lehrenden gefordert wird, dass sie Experen seien, Fachleute, dann kann man Angst bekommen vor dem Wust und der Fülle an komplexen Themen und Bereichen und weiß im ersten Moment vielleicht gar nicht, wo man beginnen mag.
Nach dem Lesen des Buches, wäre ein erster und äußerst wichtiger Ansatz, bei jedweder Planung zu berücksichtigen, wie das Gehirn funktioniert. Lehren und Lernen gänzlich darauf einzustellen und dies als Basis zu nehmen.
Laut Roth können zwingend notwendige Verbesserungen des Schulwesens nur auf diese Art und Weise realisiert werden.
Roths Buch macht immer wieder darauf aufmerksam, wie entscheidend die Persönlichkeiten von Lehrendem und Lernenden auf das Lernen einwirken.
An manchen Stellen war es mir doch sehr fachspezifisch und theorielastig, aber insgesamt macht das Werk Lust darauf, sich näher mit der Thematik auseinanderzusetzen.
Ganz offene Türen hat der Autor dann ja ziemlich am Ende seines Buches bei mir eingerannt.
Dort geht er auf Unterrichtsformen ein (S.296):
"Über die besten Unterrichtsformen wird zur Zeit viel gestritten, und vieles wird ausprobiert, ohne dass es irgendwelche empirischen Validierungen gibt. Man wird sich deshalb dem Abschied vom Traum der optimalen Unterrichtmethode anschließen müssen, wie Hilbert Meyer (2004) ihn propagiert, und stattdessen eine gesunde Mischung der drei Grundformen, nämlich von Frontal - und Lehrgangsunterricht, Gruppen- und Projektunterricht und Frei- bzw. Einzelarbeit praktizieren."
Es lohnt sich also durchaus, sich die Zeit zu nehmen, auch einmal solche Bücher durchzulesen.
Kommentare hinzufügen
Die Kommentare werden redaktionell verwaltet und erscheinen erst nach Freischalten durch den Bloginhaber.
Die Kommentare werden redaktionell verwaltet und erscheinen erst nach Freischalten durch den Bloginhaber.
Kein Kommentar zu diesem Beitrag vorhanden

Termine:
Montag, 03.09.2012
Klassenpflegschaft
19.30 Uhr
im Klassenraum
Klassenpflegschaft
19.30 Uhr
im Klassenraum







